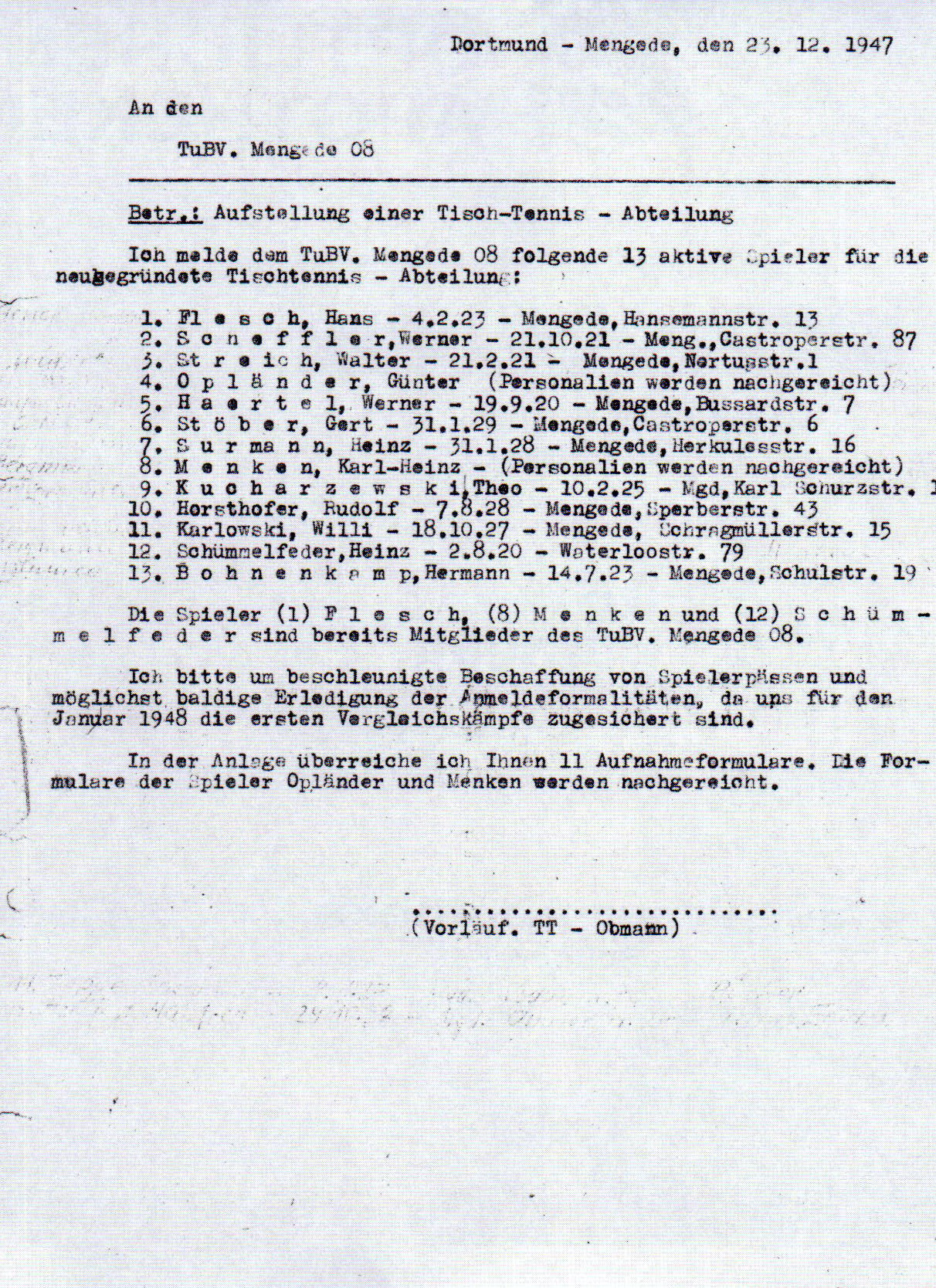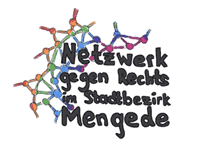…heute mit Klaus Schlichting,![sein Foto]()
Koordinator der Dortmunder Einrichtungen der
Sozialistischen Jugend Deutschlands (SJD) Die Falken – Unterbezirk Dortmund.
„Gib den Kindern das Kommando!“
An einem regnerischen Dienstagmorgen traf MENGEDE:InTakt! Klaus Schlichting im Cafe „Symbol“ am Mengeder Marktplatz. Wer Klaus Schlichting vielleicht nicht vom Namen kennt, der wird ihn spätestens auf den vielen Veranstaltungen, Straßenfesten, Ferien- und Freizeitaktivitäten im Kinder- und Jugendbereich gesehen und erlebt haben und sagen können: „Ach das ist Klaus Schlichting, den kenne ich doch schon lange“. Als ich mit ihm ins Gespräch kam, war schnell klar: Mit einer Tasse Kaffee kommen wir nicht aus. Daher waren weitere Gespräche mit dem besagten Heißgetränk vonnöten, um der Person Klaus Schlichting mit seiner ereignisreichen Biografie gerecht zu werden.
Seine Kindheit im Telegrammstil:
„Geboren am 13.06.1954 in Nette, genauer gesagt in Niedernette, in einer Großstadt, aber doch auf dem Lande. Groß geworden auf dem Bauernhof, unter Tieren auf der freien Netter Scholle. Geboren als Letzter von fünf Kindern, als Nachzögling, unehelich – damals ein Makel, aber nie gespürt. Alle Schultypen durchlaufen, Nette-Dorf-Schule (4 Jahrgänge in einer Klasse), Volksschule Nette, Hauptschule im Versuch Nr. 11 Nette, Geschwister-Scholl-Gymnasium in Brackel. Immer ein guter Schüler, getrieben von den Lehrern zu mehr, kein Streber, aber immer einer der Besten. „Laissez-fair“, im christlichen Glauben frei von der Mutter erzogen.“
Politik steht für ihn früh im Mittelpunkt
Das erste politische Buch, das er in jungen Jahren las, war „Zivilcourage“ von John F. Kennedy. Inspiriert von „Willi wählen“ und „Mehr Demokratie wagen“, trat er mit 16 Jahren in die SPD ein.
Weiter ging es mit dem Architekturstudium an der Fachhochschule Dortmund bei Prof. Wolfgang Richter und Prof. Jörn Jansen und den 4 Semestern Raumplanung an der Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg. Schwerpunkte Projektstudium und fachübergreifende Studien (interdisziplinär).
Nach 4 Jahren intensiver Arbeit bei den Jungsozialisten in der SPD reifte die Erkenntnis, dass der Gang durch die Institutionen nicht der Richtige ist. Daher kehrte er der Parteiarbeit den Rücken. Seine neue politisch-pädagogische „Heimat“ fand er bei der Sozialistischen Jugend Deutschlands, SJD die Falken.
Die ersten „Falken-Lehrjahre“ waren geprägt von intensiver Auseinandersetzung mit Revolutionstheorien (u. a. von Che Guevara und Mao Tse Tung), der Frauen-Emanzipationsbewegung, der Wirtschaftstheorien von Karl Marx, der Hausbesetzerbewegung und der damals allgegenwärtigen Rote Armee Fraktion (RAF).
Falkenseminare hatten die Themen „Sozialistische Erziehung und sozialistische Utopien“. Hinzu kam das politische Studium. Eine spannende Zeit. In der täglichen Arbeit bei den „Falken“ entwickelte sich ein „Händchen“ für Kinder. Mit Kindern und von Kindern viel über Kinder lernen. Ohne wissenschaftlichen Hintergrund sondern „learning by doing“. Frei und ungezwungen. Originalton Klaus Schlichtung: „Kinder sind kleine Menschen und so muss ihnen auch begegnet werden. Mit Respekt und Toleranz“. Frei nach Herbert Grönemeyer „Gib den Kindern das Kommando, denn sie wissen was sie tun.“
![379]()
Auf den Spuren von „Che“ (2016)
Sein Leben in den 80er Jahren war von der Arbeit mit Kindern und der Faszination, die von „Che“ Guevara ausging, geprägt. Wurde hier etwa der Grundstein für die internationale Solidarität mit Kuba und Lateinamerika gelegt? Die Arbeit mit den „Teens“ ging weit über die „normale, angepasste“ Falkenarbeit hinaus. Es hieß, immer etwas Neues auszuprobieren und anzugehen. Frei nach „Che“: „Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche.“ Immer kritisch das „Ist“ betrachten.
Auf dem Programm der Netter Falken standen einerseits Großkonzerte, zum Teil mit 600 Besuchern im PZ des Heinrich-Heine-Gymnasiums und selbstorganisierte Freizeiten von Jugendlichen in Italien und Frankreich. Andererseits beteiligten sie sich an Friedensdemonstrationen in Bonn, Anti-AKW-Demos gegen die Atom-Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf, gegen den Bau des Atomkraftwerks in Brokdorf.
![OLYMPUS DIGITAL CAMERA]()
Demo gegen Castro-Transporte im Wendland (2011)
Sie bildeten Menschenketten gegen den Nato-Doppelbeschluss, der die Stationierung von Pershing II Raketen und Marschflugkörpern ermöglichte.
Parallel dazu fand 6 Jahre lang ein Jugendaustausch mit der damals kommunistisch regierten Stadt Gennevilliers, eines Vorstadtzentrums (Banlieue) nördlich von Paris, statt. Das Ganze immer verbunden mit viel Spaß, Elan und vielen Freundschaften.
Trotz aller „Auswärtsspiele“, die Verbundenheit mit dem Ortsteil Nette blieb bestehen.
Weitere Stationen: Acht Jahre stellvertretender Unterbezirksvorsitzender bei den Falken. Vorstandsarbeit mit jungen Erwachsenen und traditionelles Falkenzeltlager im Sommer. Wer glaubt, Vorstandsarbeit führt aufgrund erforderlicher Kompromissfähigkeit zu angepasstem Verhalten, der wird bei Klaus Schlichting enttäuscht. Er steht zu seinen Prinzipien und lässt sich nicht vereinnahmen.
Aufbauarbeit in Nicaragua
![Nicaragua7]()
Aktive Aufbauhilfe 1
![Nicaragua6]()
Aktive Aufbauhilfe 2
Ende der 80er Jahre stand die Solidaritätsarbeit für die Kleinstadt San Isidro in Nicaragua im Mittelpunkt. Drei Jahre hatte die „Teenie-Gruppe“ auf Flohmärkten, Veranstaltungen und durch Bananenverkauf, gemeinsam mit dem „Städtepartnerschaftsverein San Isidro“, Geld für den Bau einer Vorschule in San Isidro gesammelt.
Freiwillige Helfer, die in Nicaragua ihre Arbeitskraft für Aufbauprojekte zur Verfügung stellten und in der Falkengruppe von ihren Erfahrungen berichteten, weckten die Neugierde bei den Kids: „Wir wollen auch nach San Isidro“. Aber da gab es viele Hindernisse, die von Klaus Schlichting zu überwinden waren. Die Reisekosten und die Unterbringung. Wer organisiert für uns in Nicaragua/San Isidro den Aufenthalt? Im Reisebüro konnte man diese Reise nicht buchen. Die Eltern mussten ihr Einverständnis geben. Und das trotz ihrer berechtigten Bedenken, wie der unübersichtlichen Sicherheitslage während der sandinistischen Revolution mit ihren von der US-Regierung unterstützten konterrevolutionären Guerillas (Contras), möglichen Infektionen mit Malaria und das Allerwichtigste: sie werden 4 Wochen nichts von ihren Kindern hören – Handys gab es noch nicht und nur schwarz-weiß Fotos – wie man sieht.
![Nicaragua8]()
Wache vor dem Aktivistencamp
„Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche.“ 1 ½ Jahre nach der ersten Idee ging es los, ab Frankfurt Flughafen, 10 Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren, 2 Betreuer und eine junge Dolmetscherin machten sich ab Frankfurt Airport auf ins Abenteuer Nicaragua. Ein Erlebnis für alle, von dem sie heute noch erzählen.
Danach wurde es bei Klaus Schlichting ruhiger, was die Falkenarbeit betrifft.
Berufsbedingt gab es 1990 für ihn einen Ortswechsel.
Der neue Job hieß Bildungsmanager. Als Regionalleiter Süd beim privaten Bildungsträger BFE war er zuständig für den Großraum Nürnberg, München und Stuttgart. Die Wochenenden gehörten für den damaligen Pendler aber weiterhin den Dortmundern.
Freitagabends ging es mit den Falken zum Reiten, und es gab viele Wochenend- und Freizeitfahrten wie z. B. 1992 in die Camargue und 1993 nach Korsika.
![OLYMPUS DIGITAL CAMERA]()
Klettern auf Korsika 2006
Es rückten dann das Reiten und Radfahren und der Job in den Vordergrund. Auf dem Programm standen unter anderem Radtouren nach Rügen, Freiburg und Saarbrücken.
1995 holte den „Netter Junge“ das Heimweh wieder heim nach Dortmund. Der Süden war zu fremd und zu arrogant.
Geplant war der Ausstieg bei den Falken und Einstieg in die Parteipolitik. So ganz funktionierte der Tausch nicht. „Einmal Falke – immer Falke“ und das Funktionärsgehabe einiger SPD-Parteigenossen bereiteten den Weg zurück zu den Falken. Ab 2002 noch intensiver. Es kam der Job bei den Dortmunder Falken als „Koordinator ihrer Dortmunder Einrichtungen“ hinzu, obwohl ein Job bei den Falken nie sein Ziel war.
Die ehrenamtliche und hauptamtliche Falkenarbeit wurde intensiver und kreativer, der politische und gesellschaftliche gestalterische Aspekt kam hinzu.
![imm016_11A]()
Klettern im Tarntal (2013)
Die traditionelle Falken-Gruppenarbeit wurde ergänzt durch „Projektarbeit“. Die ersten drei Jahre der Falkenarbeit hießen „Demokratie leben, lernen, wagen“. Die Inhalte des Projektes wurden mit Hilfe des Jugendamtes aufgezeichnet und in Form einer Ausstellung in den verschiedensten Schulen präsentiert.
Die nächsten zwei Jahre waren eine intensive Auseinandersetzungen mit den „Neonazis“. Ergebnis war ein Beratungsbüro für Fragen von Bürgern rund um das Thema „Neonazis“ in Westerfilde.
Übrigens, sein Leben lang begleitete ihn das Thema Nazis und Neonazis. Das floss immer wieder in die Falkenarbeit ein, in Form von Gedenkstättenfahrten und dem Projekt „Anne Frank“.
Falken-Gruppenräume in Westerfilde
Mit Unterstützung der Wohnungsbaugesellschaft und dem Jugendamt erhielten die Falken in der Westerfilder Siedlung Speckestraße/Gerlachstraße eine Wohnung für die Falkenarbeit, mitten im „sozialen Brennpunkt“. So war es nur logisch, dass es die drei darauf folgenden Jahre projektmäßig hieß: „Raus aus dem Ghetto.“ Mit viel Euphorie und Elan ging es an das Integrationsprojekt. Schnell lernten sie aber, dass Integration nur mit Geld und guten Willen nicht möglich ist. Integration heißt, Respekt vor den anderen, aufeinander zugehen, lernen wie sie denken, leben und fühlen. Da muss Politik noch viel lernen.
![CIMG4098]()
Präsentation der Traumschule 2011 – der OB hört zu
![IMG_0493]()
Fachgespräche mit Hannelore Kraft
Die nächsten Jahre hieß es „Mein Oberbürgermeister und ich machen Politik“. „Mein Ratsvertreter und….. “, „Mein Minister und ich ……“. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Mit dem Oberbürgermeister Ulrich Sierau wurde eine „Traumschule“ konzipiert, mit unserem Ratsvertreter Thomas Tölch einen „Boulevard der Kinderrechte für Nette“, der in den Jahren 2016/2017 im Zuge des Projektes Nordwärts und mit mehreren Partnern entstehen wird.
Das Projekt „Mein Minister und ……“ scheiterte an der Unflexibilität eines Ministers (Name ist der Redaktion bekannt).
In diesen letzten Jahren wurde der Bürgergarten in Westerfilde mit den Falken-Ideen eingerichtet. Die Falkengruppe übernahm die Patenschaft über den Bürgergarten und zu einem Baum im Obstbaum-Museum in Schwieringhausen. Bei „Appy“, wie das „Patenkind“ – ein Apfelbaum – liebevoll genannt wurde, auf der Wiese wird immer gern gefeiert und gegrillt.
![OLYMPUS DIGITAL CAMERA]()
Baumpatenschaft 2011 – der „Äppi“ wird gepflanzt
Wie viel Kompetenz und Selbstvertrauen die Falkenkids aus diesen Projekten zogen, ist hier schlecht zu beschreiben, dazu muss man an der Entwicklung der Kinder teilhaben und mit ihnen groß werden. Die Eltern danken es einem durch Vertrauen und Einsatz.
Deutlich wird das Vertrauen und die Teilnahme an der Falkenarbeit der Eltern am aktuellen Projekt „La Colmenita“, einer Solidaritätsarbeit mit einer Jugendtheatergruppe in Santa Clara auf Kuba (siehe auch: http://mengede-intakt.de/2016/04/22/cuba-si-falken-auf-den-spuren-von-commandante-che-guevara/.) Sie erlaubten den Kindern im Alter von 10-15 Jahren die Flugreise auf die größte Karibikinsel. Kuba und Kubas Menschen kennenzulernen war spannend und interessant. Nun wird weiter gesammelt und der Gegenbesuch für 2017 eingestielt.
Weiter zu Klaus Schlichting: Im Job hat er sich intensiv mit dem Thema „Falken machen Schule“ mit der verlässlichen ![Ganztagsbetreuung1]() Nachmittagsbetreuung an Schulen beschäftigt. Auch hier kennt man nun die Falken. Immer wieder hat er sich mit seinem Engagement über die Falken in die Stadtteilarbeit eingebracht und sie mitgestaltet.
Nachmittagsbetreuung an Schulen beschäftigt. Auch hier kennt man nun die Falken. Immer wieder hat er sich mit seinem Engagement über die Falken in die Stadtteilarbeit eingebracht und sie mitgestaltet.
Zu seiner Perspektive meinte er augenzwinkernd: „Ich warte auf meine Rente und auf meinen Abschied von den Falken.“ Wie MENGEDE:Intakt! ihn kennengelernt hat, wird das wohl noch eine ganze Weile dauern.
MENGEDE:InTakt! bat Klaus Schlichting, den Fragebogen von Marcel Proust* auszufüllen.
Ihr Motto/Leitspruch?
„Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche.“ Ernesto „Che“ Guevara.
„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ Aus: Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupery
Ihr Hauptcharakterzug?
Konsequent, zielstrebig und Zuhören können.
Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen?
Ich nehme mich so, wie ich bin und mach das Beste draus.
Was verabscheuen Sie am meisten?
Menschen, die lügen.
Ihr Interesse an Politik?
Wenn ich morgens aufstehe, das ist schon politisch. Jeder Mensch betreibt mit seinem täglichen Handeln Politik. Politik ist nicht ausschließlich Parteipolitik. Das verwechseln die meisten Menschen.
Glauben Sie, Gott sei eine Erfindung des Menschen?
Was denn sonst.
Welche Reform/Erfindung bewundern Sie am meisten?
Es gibt Millionen von Erfindungen und Reformen, mit positiven aber auch negativen Auswirkungen. Alle haben in der Erdgeschichte ihren Stellenwert.
Mit wem möchten Sie an einer Hotelbar ein Glas Wein trinken und dabei worüber reden?
Richard David Precht und ihm zu hören.
3 Dinge, die Sie mit auf eine einsame Insel nehmen würden?
Blöde Frage.
Sommer oder Winter?
Ich liebe einen westeuropäischen Sommer.
Ihre Hobbies?
Meine Hobbies, wenn man das so nennt, sind „Die Falken“ und Reisen. Beides zusammen macht sich gut.
Film oder Buch?
Den Film „Little big Man“ mit Dustin Hoffmann.
Die Bücher „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupery und „Zivilcourage“ von John F. Kennedy
Welchen Film haben Sie zuletzt gesehen?
Ich gehe mal davon aus im Kino. Das war der Film „Das Tagebuch der Anne Frank“. Ich bin kein großer Kinogänger. Man muss sich nicht jeden Film ansehen nur um des Kinos wegen.
Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Ahmad Mansour: „Generation Allah – warum wir im Kampf gegen religiösen Extremismus umdenken müssen“.
Ihre Lieblingsmusik?
Musik muss mir gefallen.
Ihre Lieblingsblume?
Jede Blume ist eine Schönheit. Frei nach dem kleinen Prinzen: „…aber die Blume wurde nicht fertig damit, in sich ihrer grünen Kammer auf ihre Schönheit vorzubereiten. Sie wählte ihre Farben mit Sorgfalt, sie zog sich langsam an und sie ordnete ihre Blütenblätter…..
Ihr Lieblingstier?
Jedes Tier ist wie jede Blume ein Geschöpf dieser Erde.
Essen & Trinken hält Leib und Seele zusammen – auch bei Ihnen? Wenn ja, was ist es?
Es muss mir schmecken.
* Der Fragebogen von Marcel Proust
Was denken und fühlen bekannte Zeitgenossen? Diese Fragen faszinierten die Menschen schon immer. Vorbild für diese Fragen ist der wohl bekannteste Fragebogen, der den Namen des französischen Schriftstellers Marcel Proust (1871-1922) trägt. Dieser hat ihn aber nicht entworfen, sondern nur ausgefüllt, das heisst, genau genommen sogar zweimal: Einmal als 13-jähriger auf einer Geburtstagsparty. Dann im Alter von etwa 20 Jahren einen ähnlichen Fragebogen, dem er selber den Titel «Marcel Proust par lui-même» («Marcel Proust über sich selbst») gab. Berühmt wurden die Fragen durch Publikationen z. B. in der FAZ.
MENGEDE:InTakt! hat den Fragebogen etwas aktualisiert.
Hinweis: Zum Vergrößern der Fotos diese bitte anklicken
Fotos: Klaus Schlichting
![]()